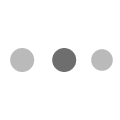Ein Blick hinter die Türen des RKI
Das Robert Koch-Institut ist das momentan wohl bekannteste Institut Deutschlands. Es ist in aller Munde und doch kann sich kaum jemand etwas Konkretes darunter vorstellen. Ich hatte das Glück und durfte fünf Wochen meines PJs in dieser Einrichtung verbringen. Ausgerechnet in Zeiten von Corona!
Das Institut selbst stellt sich auf seiner Website als „Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit vor“. Es ist eine zentrale Einrichtung – organisiert durch die Bundesregierung – für Forschung und Krankheitsüberwachung im humanmedizinischen Bereich. Dabei stehen nicht nur die Forschung und Überwachung, sondern auch die Beratung zuständiger Bundesministerien sowie die Bekämpfung von Krankheiten im Vordergrund. Letztere sind die Aufgaben, die wir Außenstehenden gerade mitbekommen. Einen Bruchteil davon, was hinter den Mauern des RKI erforscht, überwacht und beraten wird, durfte ich in den letzten fünf Wochen als Praktikantin kennenlernen.
Der erste Tag. Reflexartig strecke ich den neuen Kollegen meine Hand zur Begrüßung entgegen. Sie erwidern diese Geste. Doch kurz, bevor man die Hand der Gegenüber ergreift, überkommt es einen. Verlegen ziehen wir die Hände wieder zurück und sagen nur „Das lassen wir mal lieber. Nicht, weil ich unhöflich sein möchte, aber…“ „Corona, schon in Ordnung“, wird der Satz ergänzt.
Besondere Zeiten verlangen besondere Maßnahmen, das merkt man nicht nur bei der Begrüßung. Auch das montags stattfindende Teammeeting wurde in eine Telefonkonferenz umgewandelt. Erstes Thema der Besprechung: Corona. Es wird darüber diskutiert, wie man sich auch in den Laboren am besten schützen kann, da es dort mit den Abstandsregeln häufig schwierig wird. Organisatorische Maßnahmen werden definiert, so dass die Mitarbeiter in diesen Corona-Zeiten möglichst sicher arbeiten können.
Mittags in der Mensa, ebenfalls Corona. Die Tischanzahl wurde minimiert. Ebenso die Anzahl der Personen, die an einem Tisch sitzen dürfen. 1 Mensch – 1 Tisch, das ist die neue Regel. An die Abiturprüfung zurückerinnert, beschließen wir, ab morgen für die Mittagspause im Büro zu bleiben.

Wie das so ist am ersten Tag in einem neuen Labor: die Sicherheitsbelehrung steht an. Gedanklich stöhne ich „Wirklich, muss das sein. Ich weiß doch, dass man nicht mit dem Mund pipettieren soll…“ Warum mir ausgerechnet dieser Satz dazu einfällt? Ich weiß es nicht. Vermutlich habe ich das zu oft in Kombination mit Sicherheitsbelehrungen gehört. Doch mein Praktikumsbetreuer fädelt das Ganze sehr geschickt ein und macht aus der Sicherheitsbelehrung eine Führung durch den Labortrakt und alle anderen wichtigen Räumlichkeiten. Er erklärt dabei nicht nur, was ich beachten sollte, sondern zeigt auch gleich, was ich wo finden kann und wozu ich leider keinen Zutritt haben werde. Also die Bereiche, für die ich einen „Babysitter“ brauchen werde, wie man es mit einem Schmunzeln formuliert. Doch spätestens bei den Sicherheitslaboren ist Schluss, da reicht auch kein „Babysitter“. Hier haben nur besonders geschulte, umfassend ausgebildete und sicherheitsüberprüfte Mitarbeiter*innen Zutritt. Traurig bin ich darüber nicht. Es gibt genug Räumlichkeiten, zu denen mir Zutritt gewehrt wird und mir geht es vor allem darum, die Arbeit im Labor besser kennenzulernen.
Und dann geht es eigentlich auch schon los. Die Laborassistentin – selbst in den letzten Zügen ihrer Ausbildung – nimmt mich unter ihre Fittiche und wir beginnen zu pipettieren. Noch weiß ich nicht genau, was ich gerade tue und welchen höheren Zweck ich damit erfülle. Das ist aber nicht weiter schlimm, ich bin ja noch eine Weile hier. Genau dieses Defizit wird bereits am nächsten Tag aufgeholt. Bevor wir ins Labor gehen, erklärt mir mein Praktikumsleiter, was ich wissen möchte. Das Ziel ist es, Antikörper herzustellen, aber nicht irgendwelche, sondern monoklonale, gegen ein ganz bestimmtes Antigen. Welches das ist, variiert, je nachdem welche Experimente folgen sollen. Doch um zu diesem Ziel zu gelangen, sind einige Schritte im Voraus nötig. Da ich leider nicht zu Beginn der Versuchsreihe eingestiegen bin, helfen mir die neuen Erkenntnisse zunächst nur bedingt. Aber ich bin mir sicher, dass sich alles noch fügen wird und damit sollte ich Recht behalten. Es wird immer leichter, zu verstehen, was wir machen und welches Experiment folgt.
Für viele Versuche, wie Plasmidpräparationen oder DNA-Aufreinigungen aus Gel oder flüssigen Pufferlösungen, gibt es kommerzielle Kits, die eine Anleitung haben, der man folgen kann wie einem Kuchenrezept. Und für alle anderen Versuche gibt es mal mehr, mal weniger detaillierte Protokolle, abhängig davon, wie vertraut man mit den durchzuführenden Versuchen bereits ist. Außerdem habe ich eine tolle Laborassistentin an meiner Seite, die mir alles sooft erklärt, bis ich es verinnerlicht habe, ohne dabei genervt von mir zu sein. Ich habe wirklich Glück, mit so geduldigen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen!
Doch nach meinen ersten zwei Wochen ist ihre Zeit hier am RKI zunächst vorbei. Die letzten Monate Schule und Prüfungen stehen an. Ein bisschen traurig bin ich schon. Sie war mir nicht nur eine gute Lehrerin, sondern hat mich mit ihren oft unkonventionellen Fragen zum Nachdenken angeregt und war einfach eine wunderbare Laborbegleitung. Sehr optimistisch versichert sie mir, dass ich jetzt alles Wichtige kann und dass ich das dann ab Montag alleine machen werde. Etwas nervös nicke ich nur und denke mir „wir werden sehen“.
Am nächsten Montag stehe ich dann also das erste Mal alleine im Labor und soll Plasmide präparieren und anschließend eine 55°C Sequenzierung durchführen. Nervös und ziemlich konfus beginne ich mit meiner Arbeit. Von mir selbst genervt, so wenig Selbstbewusstsein und Sicherheit zu haben, denke ich an den Satz zurück, den mir der Projektleiter am Freitag zuvor noch sagte: „Wir haben hier keine Kaninchen, die sterben, wenn du was falsch machst. Man kann alles wiederholen.“ Das hat geholfen. Noch immer ein bisschen unsicher, aber mit deutlich mehr Selbstbewusstsein mache ich weiter und das soll sich auch gelohnt haben. Nach zwei Tagen bekommen wir die Daten aus der Sequenzierabteilung zurück, die meisten Ergebnisse sind auch zufriedenstellend und bei denen, die es nicht sind, lag es eher an den Plasmiden als an mir.
Neben zahlreichen Plasmidpräparationen und Sequenzierungen waren wir auch in regelmäßigen Abständen in der Zellkultur. Dort ziehen wir Zellen heran, die nach einer ausreichenden Wachstums- und Vermehrungsphase mit Plasmiden transfiziert werden. Doch bis dahin müssen die Zellen regelmäßig gezählt und unter dem Mikroskop beurteilt werden. Sind sie zahlreich genug gewachsen? Wie viele tote Zellen gibt es? Liegen die Lebenden in Trauben oder einzeln?
Die Plasmide, die in die Zellen transfiziert werden, wiederum tragen die DNA-Abschnitte für Antikörper. Somit haben wir, wenn alles klappt, nach der Transfektion und einer weiteren Wachstums- & Produktionsphase die gewünschten monoklonalen Antikörper. Diese sind etwas Besonderes, da von einer einzigen B-Lymphozyten-Zelllinie produziert werden und sich nur gegen ein einzelnes Epitop richten. Physiologisch vorkommende Antikörper hingegen sind stets polyklonal und folglich gegen viele Epitope verschiedener Antigene gerichtet.
Als unsere Zellen eine bestimmte Wachstumsdichte erreicht haben, konnten wir die Transfektion durchführen. Das bedeutet, dass wir fremde DNA – also die, die Information für die gewünschten Antikörper enthält – in unsere Zellen einbringen. Auch dafür gibt es ein Protokoll, dem wir strikt folgen. Anschließend werden die Zellen weiter für mehrere Tage auf dem Schüttler inkubiert. Während dieser Zeit vermehren sich die Zellen erneut und beginnen mit der Antikörperproduktion. Doch wie bekommt man genau diese Antikörper jetzt aus dem Medium, in dem auch noch die Zellen schwimmen? Dafür gibt es „Moritz“. Nein, das ist kein weiterer Laborassistent, sondern ein ÄKTA-Chromatographie-Gerät, das Proteine aufreinigt und Antikörper sind ja nichts Anderes als Proteine – bestehend aus zwei leichten und zwei schweren Ketten. Im Prinzip funktioniert das so, dass das Medium, indem sich die Proteine befinden über eine Säule transportiert wird. An dieser Säule bleiben die gewünschten Proteine „kleben“ und werden in einem anschließenden Schritt durch Puffermedien abgelöst. Anschließend misst man photometrisch die Konzentration der Lösung. Erst jetzt kann man sehen, ob die Wachstums- und Produktionsphase erfolgreich war und man wirklich genug Antikörper bekommen hat.
Bis wir soweit waren, dass wir „Moritz“ um Hilfe bitten können, sind einige Tage vergangen. In dieser Zeit habe ich weiter fleißig Plasmide präpariert und sequenziert. Außerdem durfte ich Beads koppeln und mich bei einer Gelelektrophorese versuchen. Beads, das sind winzig kleine magnetische Kügelchen, an die Antigene gekoppelt werden. Anschließend kann man mit ihnen und mit Hilfe eines weiteren Laborgerätes Antikörper detektieren. Ähnlich dem Prinzip eines ELISAs.
Auch dieser sollte mir nicht verwehrt bleiben. Zwar hatte ich nicht die Möglichkeit, einen ELISA selbstständig durchzuführen, dafür aber konnte ich mich, während sie mir das gezeigt hat, mit einer Tierärztin unterhalten, die hier am RKI promoviert. Das war sehr interessant: Ich konnte sie über ihre Zukunftspläne befragen und so selbst etwas mehr über meine diversen Möglichkeiten nach meiner Studienzeit erfahren.
Waschtag stand an. Nein, das bedeutet nicht, dass ich die ehrenvolle Aufgabe hatte, Laborgerätschaften zu waschen. Es ist die liebevolle Bezeichnung für einen eher etwas langweilig anmutenden Western-Blot-Tag einer Laborassistentin. Am Tag zuvor haben wir gemeinsam Gele beladen und laufen lassen, damit sich die Proteine ihrer Größe nach auftrennen. Der darauffolgende Tag – der Waschtag – diente dann zum Blotten und das beinhaltet viele (sehr viele!) Waschschritte. Ein richtiger Waschtag eben. Die unzähligen zehnminütigen Wartepausen zwischen den einzelnen Waschschritten schienen zunächst sehr langsam zu vergehen. Dank interessanter Gespräche über meine Zukunftspläne, ihre Kinder und weitere diverse Themen wie Politik und dem Unterschied zwischen Bayern und Berlinern verging die Zeit aber doch im Nu und ein weiterer Tag verging viel zu schnell.
Abschließend kann mich nur wiederholen: Diese fünf Wochen am Robert Koch-Institut vergingen viel zu schnell. Ich habe so viel gelernt und hatte stets etwas zu tun oder zu recherchieren und langweilig wurde mir eigentlich nie. Auch über meine Kollegen könnte ich mich niemals beschweren. Sie waren so nett, hilfsbereit und geduldig mit mir. Ich hatte wirklich Glück!
Zwar muss ich gestehen, dass ich mir nicht vorstellen könnte, für immer in einem Labor zu arbeiten. Entscheide ich mich für eine wissenschaftliche Karriere in diesem Sinne, wird das vermutlich eh nicht zutreffen, da die Wissenschaftler*innen die meiste Zeit in ihrem Büro vor dem Computer verbringen und die Daten auswerten, die ihre Laborassistent*innen generieren. Das ist deswegen nicht weniger interessant, es wäre vermutlich nur nicht das, was ich mir für meine Zukunft vorstellen würde. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Genau dafür ist so ein Praktikum ja da und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich diese Chance genutzt habe, da ich mir durchaus trotzdem vorstellen kann, für eine gewisse Zeit nach dem Studium wissenschaftlich arbeitend in einem Institut wie dem RKI tätig zu sein.
Was mir zunächst ebenfalls Schwierigkeiten bereitete, war das molekularbiologische Arbeiten. Man pipettiert zumeist klare Flüssigkeiten in winzigen Mengen im µl-Bereich – kaum sichtbar für das menschliche Auge. Es ist tatsächlich schwieriger als gedacht, dabei den Überblick zu behalten und stets zu wissen, was man gerade tut. Dafür ist definitiv viel Vorwissen und Vorstellungskraft nötig und das stellte mich regelmäßig vor Herausforderungen.
Dennoch bin ich überglücklich, dieses Praktikum gemacht zu haben und ich kann nur jeden ermutigen, einmal ein Praktikum in einem Bereich zu machen, den man sich nur vielleicht und eventuell vorstellen kann. Am Ende ist es dann doch genau das, was am meisten Spaß macht! Über den Tellerrand zu schauen hat noch nie geschadet, auch das hat mir das Praktikum beigebracht und das positive Feedback meiner Kollegen und meines Praktikumsleiters hat mich sehr gestärkt und mir weiter Motivation für alles, was noch folgen soll, gegeben!
· SE ·