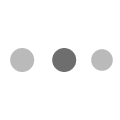Wer viel sehen und lernen möchte, muss in die Ferne gehen! Wer bequem leben möchte, sollte zu Hause bleiben.
… haben sie gesagt. Da stehe ich, zu Beginn des fünften Semesters. Ganz klischeemäßig bin ich nach dem Abi ins Ausland gegangen und habe dank meines akzeptablen Abitur-Schnittes ziemlich schnell einen Studienplatz bekommen. Und dann, ab nach Berlin. Keine Ahnung von nichts, null praktische Erfahrung. Nicht mal ein Schulpraktikum beim Tierarzt, muss ich mir bei der Vorstellungsrunde zum Studienbeginn knirschend eingestehen.
Jetzt soll ich mir einen Praktikumsplatz für das Kleine Kurative Praktikum suchen. Schnell, sonst sind die guten Plätze weg. Aber was zum Teufel ist ein guter Platz? Bisher bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich lieber Groß- oder Kleintiere machen möchte.
In die Ferne gehen soll ich. Außer den Tierärzten in meiner Heimatstadt und meinem Tierarzt hier in Berlin kenne ich weder namhafte Kliniken noch besonders „gute“ Praxen. Aber wieso muss ich denn unbedingt in die Ferne? Woher weiß ich denn, dass ich dort mehr lerne, als zu Hause?
Nach langem Überlegen fasse ich einen Entschluss. Da ich sowieso in den mir verbleibenden drei Wochen Ferien kein vierwöchiges Praktikum absolvieren kann, nehme ich mir vor, mich für zwei Wochen bei einer Tierarztpraxis in meiner Heimat zu bewerben. Um das Ganze mal auszutesten.
So. Wie genau bewirbt man sich für etwas, in dem man 0,0 Vorkenntnisse hat? Nimmt überhaupt jeder Tierarzt Praktikanten an? Um auf Nummer sicher zu gehen, rufe ich einmal dort an. Die Dame am Telefon klingt nicht begeistert. Eigentlich nehmen sie keine Praktikanten mehr und was ich denn überhaupt so mache. Ich erkläre ihr, dass ich Veterinärmedizin studiere und das Praktikum im Rahmen meines Studiums absolvieren muss. Ein genervtes Stöhnen, dann das Zugeständnis „Ja, da kann man dann auch mal ne Ausnahme machen.“ Sie klärt das mit dem Chef. Ich soll mal einen Brief schreiben, mit ein paar Infos über mich und wann genau ich denn kommen will. Und dann kommt gar nichts mehr… wochenlang. Eine klare Zusage habe ich ja nicht bekommen. Einige Wochen vor dem Praktikum rufe ich noch mal an. „Ja, klar können Sie kommen. Ne, ´ne Zusage per Brief gibt’s nicht. Für sowas haben wir ja keine Zeit!“ lautet die ziemlich ruppige Antwort am Telefon. Ich soll einfach am ersten Praktikumstag um 9 da sein und Gummistiefel mitbringen. Tschüss.
Los geht‘s
 Etwas mulmig ist mir zumute, als ich am besagten ersten Praktikumstag losfahre. Die Praxis liegt in meiner Heimatstadt, dort wohnen etwa 35.000 Einwohner. Um die Stadt herum ist in einem Umkreis von einigen Kilometern nichts außer Wald, kleine Dörfer und ein paar vereinzelte Bauernhöfe. Über den Tierarzt weiß ich nicht allzu viel. Er ist der typische Landtierarzt, macht Klein- und Großtiere. Die Meinungen über ihn sind unterschiedlich. Einige schwören auf ihn, den einzigen Großtierarzt weit und breit. Seit Jahrzehnten hat er eine Praxis in unserer Stadt und irgendwie kennt ihn jeder. Andere halten ihn für „grob“ und von der alten Schule.
Etwas mulmig ist mir zumute, als ich am besagten ersten Praktikumstag losfahre. Die Praxis liegt in meiner Heimatstadt, dort wohnen etwa 35.000 Einwohner. Um die Stadt herum ist in einem Umkreis von einigen Kilometern nichts außer Wald, kleine Dörfer und ein paar vereinzelte Bauernhöfe. Über den Tierarzt weiß ich nicht allzu viel. Er ist der typische Landtierarzt, macht Klein- und Großtiere. Die Meinungen über ihn sind unterschiedlich. Einige schwören auf ihn, den einzigen Großtierarzt weit und breit. Seit Jahrzehnten hat er eine Praxis in unserer Stadt und irgendwie kennt ihn jeder. Andere halten ihn für „grob“ und von der alten Schule.
Ich betrete die Praxis und werde unerwartet freundlich von den TFAs empfangen. Grinsend werde ich hereingerufen und jeder stellt sich vor. Nach dem Telefongespräch hatte ich diese angenehme Stimmung nicht erwartet. Ich hatte wohl mit der Buchhalterin gesprochen, sie findet Praktikanten nicht so toll. Wohl aus Versicherungsgründen. Schließlich treffe ich auch auf den Tierarzt. Er ist sicherlich mindestens 60 Jahre alt. Die Kleintier-Sprechstunde beginnt ziemlich zeitgleich mit meiner Ankunft in der Praxis. Eine TFA zeigt mir den Pausenraum, dann soll ich mir einen Kittel aussuchen und los geht’s. „Der Chef ist in Raum 1.“ Okay, dann gehe ich da wohl auch mal hin. Den ganzen Morgen folge ich ihm unauffällig. Nach der Sprechstunde geht es in den OP. Während er mit geübten Griffen eine Katze kastriert, werde ich von dem Tierarzt und einer TFA ausgefragt. Wie alt ich bin, wo ich studiere und wo mein Elternhaus ist. Im wievielten Semester ich studiere und was ich später mal machen will. Okay, da hat wohl keiner meinen Brief gelesen. Wir kommen gut ins Gespräch. Direkt bei der ersten OP schaut er mich grinsend an: „Hast du schon mal Eierstöcke gesucht?“ Nö, gebe ich zu. Er erklärt mir die Handgriffe und drückt mir das nötige Instrument in die Hand. Ich bin super aufgeregt. Sowas habe ich noch nie gemacht. Mit seiner Anleitung finde ich den Eierstock und ernte ein anerkennendes Grinsen von der TFA. Klasse, gleich mal nen guten Eindruck gemacht. Nach der OP muss ich erst einmal gestehen, dass ich noch nie Medikamente injiziert habe. Um ehrlich zu sein, hatte ich noch nie wirklich eine Spritze in der Hand.
Probieren geht über studieren
Im Laufe der ersten Woche muss ich mir oft eingestehen, dass meine praktische Erfahrung wirklich gleich Null ist. Die TFAs und der Tierarzt haben dafür allerdings viel Verständnis. In aller Ruhe wird mir jeder kleinste Handgriff erklärt, gezeigt und beim Ausprobieren wird mir über die Schulter gesehen. Während der Kleintier-Sprechstunde folge ich dem Tierarzt auf Schritt und Tritt, halte die Tiere fest, verabreiche Medikamente und nehme Blut ab. Von Anfang an darf ich bei den OPs assistieren, während die TFA neben mir steht und mir sagt, was ich tun muss.
Am Mittag macht der Tierarzt eine Pause. Wobei, ob man das wirklich Pause nennen kann?! Er stürzt einen Kaffee runter und erledigt nebenbei noch 300 Dinge auf dem Hof, packt das Auto neu und führt etwa 25 Telefonate. Wir setzen uns in sein Auto – es ist nicht sehr sauber und nicht sehr aufgeräumt. Eine ziemlich alte Familienkutsche. Er erklärt mir, dass es sich für ihn nicht lohnt, einen schicken SUV zu kaufen. Durch die holprigen Fahrten über die verschiedensten Schleichwege würden sich die Autos sehr schnell abnutzen. Auch das scheint ein Aspekt zu sein, der der Großtierpraxis ganz eigen ist – die Kenntnis über sämtliche versteckten Schleichwege in der Gegend, um möglichst schnell von A nach B zu kommen. Der Tierarzt macht sich jedes Mal einen Spaß daraus: Wir fahren über irgendeinen Weg durch irgendeinen Wald, plötzlich lichten sich die Bäume und wir stehen in einem Dorf. „Wo sind wir jetzt?“ Peinlich, fast 20 Jahre habe ich in der Region gewohnt und bin dennoch komplett orientierungslos.
Wir machen unsere Tour zu den Reitvereinen, privaten Offenställen und landwirtschaftlich geführten Betrieben. Ab und zu fahren wir auch zu Kleintier-Patienten nach Hause. Für die besonders jungen, alten oder kranken Hunde und Katzen. Auf den Autofahrten, die einen nicht unerheblichen Anteil des Tages ausmachen, unterhalten wir uns viel. Er erzählt mir von seinem beruflichen Werdegang, von den Vorteilen der Groß- und der Kleintierpraxis und davon, wie bei uns die Höfe sterben. Das ist ein großes Thema, wovon in der Uni zwar geredet wird, dessen Ausmaße einem aber nicht wirklich bewusst werden. Bis man auf dem Weg von Hof zu Hof an einer riesigen Zahl leerstehender Gebäude vorbei fährt. Er kann mir noch immer jeden Bauern namentlich nennen, der in diesen verlassenen Ställen noch vor einigen Jahren seinen Lebensunterhalt bestritten hat. Der Großteil der Bauern, die wir besuchen, ist auffällig alt. Die meisten bereits weit über dem Rentenalter. Hier fällt auch auf, dass sowohl Stallbauten als auch das Management lange nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Nachwuchs gibt es selten, die Nachkommen der Landwirte sind in den einige Kilometer entfernten größeren Städten und haben dort einen guten Job, um die frisch gegründete Familie zu ernähren. Irgendwo ist das auch verständlich. Allgemein bekannt ist ja, dass es als kleiner landwirtschaftlicher Betrieb auf dem Land generell nicht mehr allzu lohnenswert ist. Dazu kommen die schlechten Böden in unserer Region und die mittelmäßige Infrastruktur.
Der Großtierarzt und die Landwirte
Der Tierarzt erzählt mir von seinen Preisen. Möglichst gering, da sich die Bauern die Behandlungen inklusive Anfahrt kaum noch leisten können. Immer wieder höre ich von Tierärzten, die sich über das Preisdumping der anderen beschweren. Ich weiß nicht, was ich von diesen Themen halten soll. Er hat ja Recht, aber er selbst könnte sich das Leben auch deutlich einfacher machen. Über 60 Jahre, bereits den ersten Bandscheibenvorfall überstanden, arbeitet er jeden Tag von 7 bis 21 Uhr wenn nötig. Eigentlich würde er gerne mit der Großtierpraxis aufhören, er findet aber keinen Nachfolger. Aufhören kann er auch nicht, was sollen die letzten verbliebenen Landwirte denn dann machen? Ein bisschen wehmütig erzählt er mir von der Zeit, in der er wöchentlich mehrere Geburten betreute.. Oder in der die Zahl der Besamungen noch mehr als dreimal so hoch war. Jetzt ist das anders.
Während der Touren behandeln wir alle möglichen Spezies: verwurmte Alpakas, trächtige Ziegen und brünstige Milchrinder. Er „weiß von allem ein bisschen was, und nichts so richtig.“ Als Groß- und Kleintierarzt hat er ein breites Wissen über die verschiedenen Spezies, für komplexe Operationen schickt er die Tiere in die nahe gelegene Klinik. Wenn die Besitzer entspannt sind, lässt er mich ziemlich viel mithelfen. Ich darf impfen, Blut abnehmen, meinen kläglichen Beitrag zur Trächtigkeitsuntersuchung leisten. Mein absolutes Highlight war die Geburt eines kleinen Lämmchens. Wir kamen auf dem Hof an und wurden von einem ziemlich alten Mann empfangen. Einer der drei Schäfer in unserer Gegend. Er zeigte uns das Schaf, bei dem die Fruchtblase bereits zu sehen war. Im Laufe der Geburt befestigten wir Bänder an den Vorderbeinen des Lammes und ich zog es heraus, da das Mutterschaf ziemlich schwach war. Als das Lämmchen auf der Welt war, rieb ich es mit Stroh ab und legte es seiner Mutter vor. So macht die Nutztierpraxis ziemlich viel Spaß.
Landtierarzt- ein Kompromiss?
Es gibt auch weniger schöne Begegnungen. Halb verwilderte Fleischrinder, die in baufällige Untersuchungsstände getrieben werden. Solche Momente schrecken mich ziemlich ab. Ich habe nicht vor, mich künftig in Lebensgefahr zu begeben, nur weil die (Hobby-)Landwirte ihr Management nicht im Griff haben. Der Tierarzt ist auch nicht begeistert von diesen Betrieben, aber „irgendwer muss es ja machen.“ Generell habe ich oft den Eindruck, dass der Tierarzt sich teilweise etwas zu sehr aufopfert für den Job. Selten hat er Zeit, sich mit seinen Kindern zu beschäftigen oder seinen Hobbys nachzugehen. Für ihn scheint der Job wirklich die Erfüllung schlechthin zu sein. Trotzdem glaube ich, dass wenigstens ein bisschen Work-Life-Balance nicht schaden würde. Auch das „Mit-der-Zeit-gehen“, das ich besonders in der Medizin für ziemlich wichtig halte, leidet. Er besitzt kein Smartphone und ist sehr überrascht, wenn ich augenscheinlich große Probleme löse, indem ich die Antwort einfach google. Manchmal muss ich mir auch ein bisschen auf die Zunge beißen. Nicht alle im Betrieb sind auf dem neusten Stand, was die Wissenschaft angeht. Ab und zu werden Empfehlungen ausgesprochen, die ich mit meinem – zugegeben unausgereiften Uniwissen – nicht so unterschreiben würde. Gehört das zu den zwangsläufigen Begleiterscheinungen, wenn man eine Praxis im Landarzt-Stil führt?
Häufiger in diesen zwei Wochen sprechen wir darüber, dass er einen Nachfolger sucht. Die TFAs raten mir, mich „gut zu stellen mit ihm“. In einigen Jahren möchte er die Praxis übergeben. Die Vorstellung, nach einer lehrreichen Assistenzzeit eine derartige Praxis zu übernehmen, klingt irgendwie idyllisch. In der Nähe meines Elternhauses, umgeben von Familie und jahrelangen Freundschaften. Dabei in der wunderschönen Gegend leben, in der ich aufgewachsen bin. Das wäre ein krasser Gegensatz zu meinem Leben im geschäftigen Berlin. Aber eine Überlegung wert. Muss das so sein? Dass man kaum Zeit hat, sich um sich selbst und die Familie zu kümmern? Und irgendwie den Anschluss verliert, nur weil man geografisch gesehen so weit von den Städten entfernt ist, in denen Forschung betrieben wird?
Und am Ende…
Am Ende der zwei Wochen bin ich ein bisschen traurig. Wie so oft in diesem Studium bin ich erstaunt, wie viel man in so kurzer Zeit lernen kann. Ich wurde sehr nett aufgenommen und in den Praxisalltag integriert. Auch die Resonanz war gut – es hätte allen Spaß gemacht, mir Dinge beizubringen. Neben dem vielen spannenden Input bin ich auch Dingen begegnet, über die ich viel reflektiert habe und die ich eventuell anders machen würde. Aber das ist wahrscheinlich auch normal.
Trotzdem kann ich sagen, dass es kein Fehler war, nicht „in die Ferne“ zu gehen. Ich durfte meinen Möglichkeiten entsprechend ziemlich viel praktisch machen und habe einen guten Einblick in einen eventuellen „Zukunftsplan“ erhalten. Wahrscheinlich hätte ich in einer größeren Klinik mehr komplexe OPs und aufregende Notfälle gesehen. Aber da wäre ich vielleicht auch nicht so sehr eingebunden worden. Erstmal bin ich zufrieden. Schließlich habe ich ja auch noch ein paar Jahre, um andere Praktika zu machen. ·EZ·